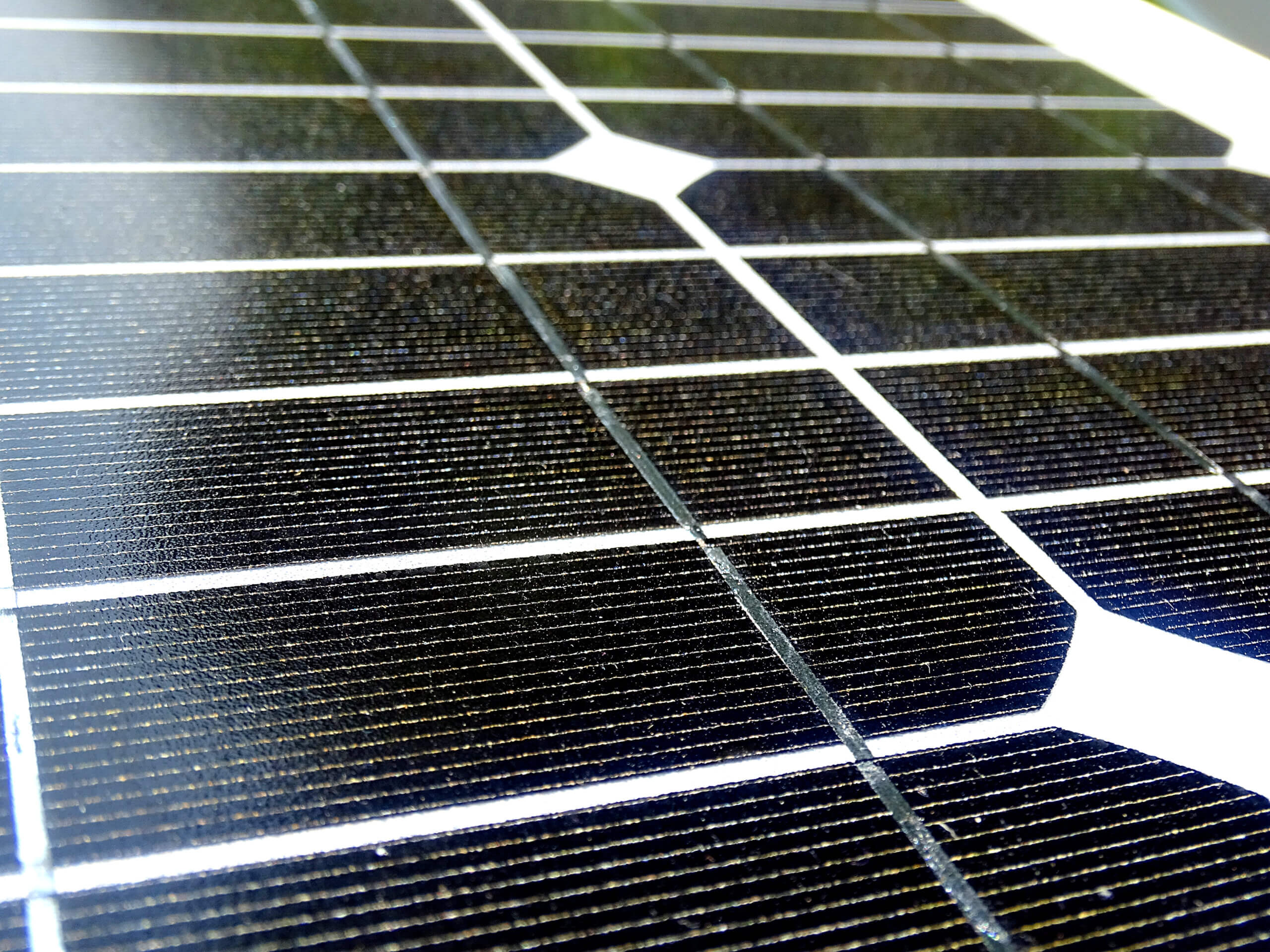Der Mantelerlass verändert den Markt
Mit dem Inkrafttreten des zweiten Teils des sog. Mantelerlasses zum Stromversorgungsgesetz treten per 1. Januar 2026 tiefgreifende Neuerungen in Kraft. Neben den bekannten Formen des Eigenverbrauchs wie dem Zusammenschluss zum Eigenverbrauch (ZEV) oder dem Praxismodell kommt die Lokale Elektrizitätsgemeinschaft (LEG) hinzu. Dieses neue Instrument erlaubt erstmals den gemeinschaftlichen Stromhandel über das öffentliche Verteilnetz – eine kleine Revolution im Schweizer Energierecht.
Für private und institutionelle Liegenschaftsbesitzer bedeutet das: Die Spielräume für Eigenverbrauch von Photovoltaikstrom werden breiter. Doch die Wahl des richtigen Modells ist nicht nur eine technisch, sondern auch eine juristisch anspruchsvolle Frage.
ZEV und vZEV: Der Klassiker im Eigenverbrauch
Das ZEV-Modell ist in Art. 17 und 18 Energiegesetz (EnG) und Art. 14 ff. Energieverordnung (EnV) verankert. Mehrere Endverbraucher – typischerweise Stockwerkeigentümer und / oder Mieter in einem Mehrfamilienhaus – werden hinter einem einzigen Netzanschluss zusammengefasst. Der ZEV gilt gegenüber dem Verteilnetzbetreiber als ein Kunde. Für den intern verbrauchten Solarstrom fallen keine Netznutzungsentgelte an. Für Mieter gelten preis- und informationsrechtliche Schutzvorschriften (Art. 16 EnV).
Seit Anfang 2025 gibt es zusätzlich den virtuellen ZEV (vZEV, Art. 14 Abs. 3 EnV). Hierbei können die bestehenden Zähler des Verteilnetzbetreibers als virtueller Messpunkt und die Anschlussleitungen genutzt werden. Das spart Kosten und erleichtert die Umsetzung, insbesondere bei Arealen mit mehreren Gebäuden. Der vZEV bleibt eine Einheit, d.h. ein Kunde gegenüber dem Verteilnetzbetreiber.
Praxismodell und vPraxismodell: Eine prüfenswerte Alternative
Das sogenannte Praxismodell ist keine gesetzliche Kategorie, sondern ein pragmatischer Ansatz, den die ElCom in ihren Mitteilungen konkretisiert hat. Verteilnetzbetreiber sind nicht verpflichtet, es anzubieten. Auch nicht nach dem Inkrafttreten des Mantelerlasses. Alle Teilnehmenden bleiben individuelle Endverbraucher und behalten ihren eigenen Netzanschluss. Der lokal erzeugte Solarstrom wird dennoch direkt zwischen Betreiber und Verbrauchern auf der Basis eines Energieliefervertrags abgerechnet. Juristisch handelt es sich um privatrechtliche Verträge, die keiner spezifischen Regulierung wie im ZEV unterliegen.
Das virtuelle Praxismodell (vPraxismodell), seit 2025 zulässig, erlaubt die Mitbenutzung der Anschlussleitungen auf Niederspannungsebene. Damit wird eine ähnliche Infrastrukturflexibilität erreicht wie beim vZEV, allerdings ohne die Schutzmechanismen des EnG für Mieter. Gerade für gewerbliche Areale oder Mischliegenschaften kann dieses Modell interessant sein.
LEG ab 2026: Strom teilen auf Gemeindeebene
Die Lokale Elektrizitätsgemeinschaft (LEG) ist die grosse Neuerung ab 2026. Grundlage sind die revidierten Bestimmungen in Art. 17d und 17e StromVG(neu) und Art. 19e ff. StromVV(neu). Eine LEG darf innerhalb einer Gemeinde, auf derselben Netzebene und im gleichen Netzgebiet Strom handeln – auch über das öffentliche Verteilnetz (Art. 17d Abs. 2 und 3 StromVG(neu).
Teilnahmeberechtigt sind nur Haushalte und Betriebe mit Smart Meter. ZEVs oder vZEVs können als Einheit Mitglied einer LEG werden. Für den innerhalb der LEG gehandelten Strom wird ein reduziertes Netznutzungsentgelt fällig (Abschlag von 40 %, bei mehreren Netzebenen halbiert, Art. 19h Abs. 1 und 2 StromVV(neu)). Abgaben wie der Netzzuschlag, Systemdienstleistungen der Swissgrid oder die Abgaben und Leistungen an Gemeinwesen bleiben hingegen bestehen (Art. 19h Abs. 5 StromVV(neu)).
Dieses Modell schafft neue Chancen: Ein Quartier kann gemeinsam die lokale Produktion nutzen, auch wenn nicht jede Partei eine eigene PV-Anlage betreibt. Zugleich sind die Anforderungen an Organisation, Abrechnung und Vertragsgestaltung deutlich höher.
Chancen und Risiken im Überblick
Die Bandbreite der Modelle eröffnet passgenaue Lösungen:
- ZEV/vZEV sind für Mehrfamilienhäuser oder Areale mit klarer Eigentümerstruktur häufig die beste Lösung.
- Praxismodell/vPraxismodell punktet mit einfacher Umsetzung und Vertragsfreiheit. Der Verteilnetzbetreiber ist jedoch nicht verpflichtet, es anzubieten. Es kann sich für gewerbliche Areale oder Mischliegenschaften eignen.
- LEG bringt die Chance, ganze Quartiere oder Gemeinden in die Energiewende einzubinden – mit Skaleneffekten, aber auch erhöhtem Koordinationsaufwand.
Ein Stolperstein aller Modelle bleibt die Messinfrastruktur. Ohne Smart Meter ist eine rechtssichere Abrechnung kaum möglich. Die Frist zum Abschluss des Smart Meter Rollouts endet erst per Ende 2027. Verlangt ein ZEV oder LEG allerdings die Installation, besteht neu die Pflicht des Verteilnetzbetreibers, innert drei Monaten Smart Meter zu installieren (Art. 17a Abs. 3 StromVG(neu) und Art. 8adecies Abs. Abs. 6 StromVV(neu)). Zudem sind die Pflichten der Verteilnetzbetreiber unterschiedlich: Während ZEVs und LEGs gesetzlich zu ermöglichen sind, besteht beim Praxismodell keine solche Pflicht.
Fazit: Welches Modell passt?
Ab 2026 stehen in der Schweiz drei unterschiedliche Eigenverbrauchsmodelle zur Verfügung, zwei davon auch in einer virtuellen Variante. Jedes Modell hat seinen Platz: vom klassischen ZEV, über flexible Praxismodelle bis zur neuen LEG für ganze Gemeinden. Die Wahl hängt von Eigentümerstruktur, Zielgruppe und Risikobereitschaft ab.
Wer frühzeitig die Weichen stellt, kann nicht nur Stromkosten senken, sondern auch den Wert seiner Liegenschaft steigern und die lokale Energiewende aktiv mitgestalten.
Wir begleiten Sie bei der Wahl und Umsetzung des passenden Modells – Kompetent, Effizient, Transparent.